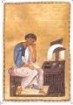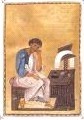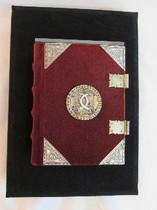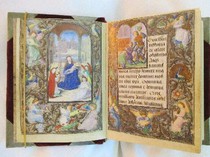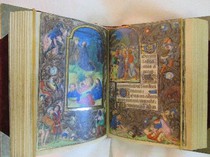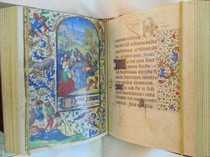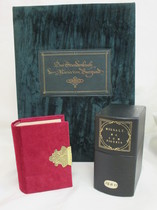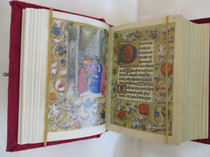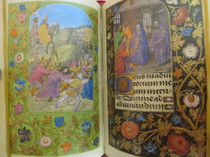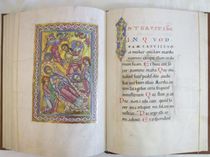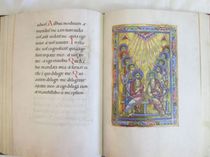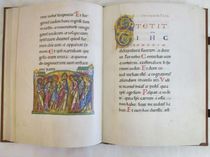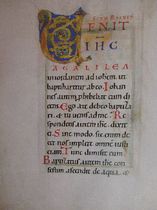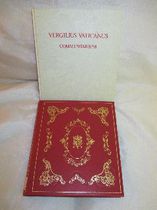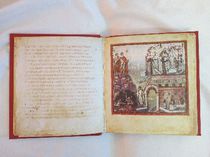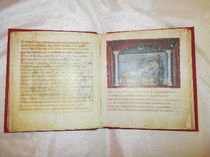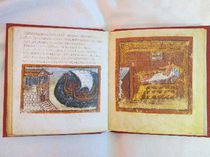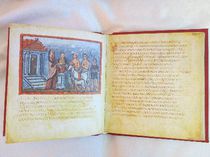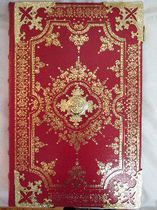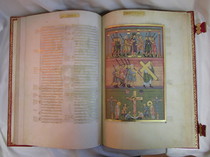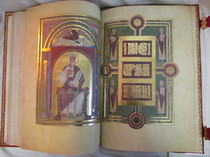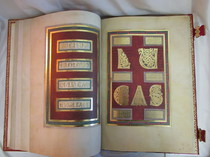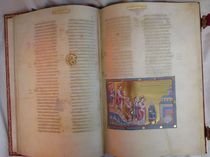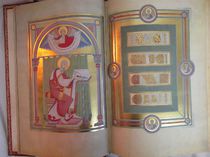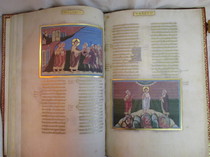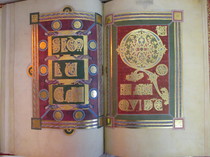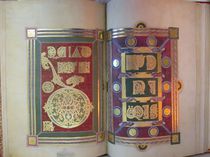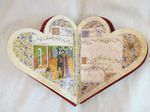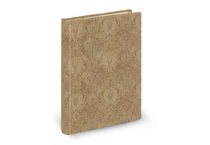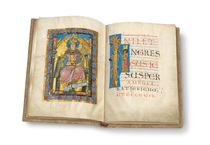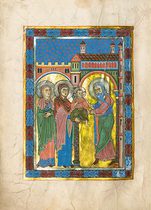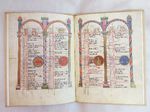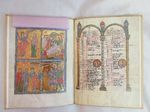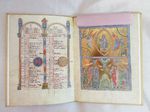Neuzugänge
Gebetbuch Karl des Kühnen
Entstanden: 15 Jahrhundert
Los Angeles, Getty Museum,
Umfang: 318 Seiten
Format: 12,4 x 9,2 cm
Miniaturen : 47 Miniaturen, über 360 Initialen
Einband: Purpurfarbener Samteinband, unter Akrylhaube.
Vorder- wie auf der Rückseite jeweils vier vergoldete Eckbeschläge und ein vergoldetes, mit verschlungenen Hörnern verziertes Medaillon. Zwei Schließen aus vergoldetem Messing.
Auflage: 980 limitierte Exemplare
Inkl. Kommentarband
Faksimile Verlag Luzern
Das persönliche Gebetbuch des burgundischen Herzogs Karl der Kühne, erkennbar an drei Porträts des Auftraggebers, ist auf jeder Seite reich verziert und mit Gold ausgestattet. Der Codex spiegelt so den Luxus Burgunds wider und nimmt eine Schlüsselstellung in der Geschichte der flämischen Buchmalkunst ein.
Karl der Kühne, Herzog von Burgund, lies von Lieven van Lathem, dem Wiener Meister der Maria von Burgund sowie dem Schreiber Nicolas Spierinc ein Gebetbuch zum persönlichen Gebrauch anfertigen, das heute im Getty Museum in Los Angeles gehütet wird: das Gebetbuch Karls des Kühnen. Es legt Zeugnis davon ab, dass der mächtigste Mann in Europa auch als Mäzen nicht seinesgleichen hatte – ist doch das Buch Seite für Seite mit Gold ausgestattet!
Auf insgesamt 47 Miniaturen entfaltet sich die überbordende Pracht burgundischer Bücherliebe. Die zeichnerische Fabulierlust setzt sich bis in die erfindungsreichen Bordüren fort, wo sich zwischen farbigem Akanthus und Goldpollen ungezählte Drôlerien, Menschen und Vögel tummeln. Drei Porträts des Auftraggebers belegen die sehr persönliche Beziehung Karls zu seinem Gebetbuch.
Auch die Textseiten sind mit reichem Schmuck versehen. Die feine Kalligraphie wird von mehr als 360 Initialen auf zumeist ziseliertem Goldgrund gegliedert; jede Textseite ist zudem mit einer ornamentalen Bordüre verziert. So spiegelt das Gebetbuch Karls des Kühnen Seite für Seite Pracht und Luxus Burgunds wieder.
Das Mainzer Evangeliar
Entstanden: Um 1250
Strahlende Bilder - Worte in Gold
Format: 35.3 x 27.0 cm
Umfang: 200 Seiten
Miniaturen: 71 biblische Darstellungen und über 300 Initialen
Ganz in Gold geschriebener Evangelientext
Inkl. Kommentarband
Auflage: 980 Exemplare
In einem Evangeliar sind die vier Evangelien des Neuen Testaments nach Matthäus, Markus, Lukas
und Johannes zu einem Band vereinigt. Ein außerordentlich reicher und viel gestalteter Buchschmuck illustriert im Mainzer Evangeliar die Erzählungen vom Leben und Wirken Jesu: ganzseitige Miniaturen
und gerahmte Streifenbilder auf
hochpoliertem Goldgrund, Kanontafeln und mehrzeilige große ornamentale Initialen zieren die 200 Seiten der Handschrift.
Das Berliner Stundenbuch der Maria von Burgund und Kaiser Maximilians
Entstanden: 1480, Brügge
Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin
Umfang: 726 Seiten
Format: 10,3 x 7 cm
Miniaturen: 27 ganzseitige Miniaturen, 11 größere Miniaturen, 36 Kleinbilder, 16 Ornamentseiten
Einband: Bordeauxroter Samt mit einer vergoldeten Schließe aus Sterlingsilber
Inkl. Kommentarband
Auflage: 980 nummerierte Exemplare
Die Verbindung der Häuser Habsburg und Burgund durch die Heirat zwischen Maria von Burgund, der einzigen Tochter und Erbin Karls des Kühnen, und dem Sohn Kaiser Friedrichs III., Maximilian, war trotz dahinter stehender politischer Erwägungen ein romantisch-idyllisches Intermezzo und führte zu persönlichem Liebes- und Familienglück.
Im Zuge dieser Verbindung aus dem Jahre 1477 entstand eine der schönsten Bilderhandschriften des burgundischen Fürstenhauses: Das Berliner Stundenbuch der Maria von Burgund und Kaiser Maximilians I.. Der Buchmaler erschließt Innenräume und weite Landschaften und tritt mit den besten Tafelmalern seiner Zeit in einen Wettstreit, bei dem die Buchkunst nicht selten triumphiert. Sogar der große Simon Bening hielt später so manche Bildidee aus dem Stundenbuch für zeitlos gültig.
Die Schatzbibel des Mittelalters
Umfang: 96 Seiten
Format: 18,6 x 14,9 cm
Entstehung: Um 1250
Miniaturen: 48 Ganzseitige Miniaturen auf leuchtendem Goldgrund
Inkl. Kommentarband
Dieses Band enthält eine Reihe von Miniaturen mit Szenen aus GENESIS und Exodus. Der Band wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts im Nordosten Flanderns in Frankreich illuminiert.
Das Schatzbibel des Mittelalters enthielt möglicherweise ursprünglich eine Reihe einleitender Miniaturen für einen Psalter, es ist jedoch wahrscheinlicher, dass es sich um ein Beispiel für eine seltene Art illustrierter Bibelsammlung handelt, die als „illustriertes Bibelbuch“ bekannt ist.
Das Perikopenbuch von St. Peter
Ein romanisches Meisterwerk aus dem früheren Besitz von St. Erentrud in Salzburg
Entstanden: Um 1150
Bayerische Staatsbibliothek
Umfang: 212 Seiten
Format: 22 x 31 cm
Miniaturen:
55 Miniaturen (davon 33 ganzseitig), 6 Seiten mit einem Verzeichnis der 71 Perikopen, 1 Initialzierseite und 81 figürliche
und Rankeninitialen.
Einband: Lederdecke mit exakt vom Original abgenommener Prägung, Handheftung auf vier echte, erhabene Bünde, handumstochenes Kapital, 2 Metallschließen
Auflage: 480 nummerierte Exemplare
Inkl. Kommentarband
Antiquarisches Exemplar
Auf den 206 Seiten des Perikopenbuches von St. Peter breitet sich vor dem Betrachter ein Bild- und Dekorationsprogramm aus, das sowohl quantitativ als auch qualitativ seinesgleichen sucht. Von den Miniaturen, die den Lesungen zum Weihnachts- und Osterkreis, zu den Heilungs- und den Erweckungswundern Christi, den Marien- und Heiligenfesten sowie dem Fest der Kreuzauffindung und -verehrung vorangestellt sind, ist weit mehr als die Hälfte ganzseitig. Breite Rechteckrahmen mit ornamentierten Füllungen zwischen goldenen und silbernen Leisten fassen die biblischen Szenen wie Tafelbilder ein. Wertvolles Blattgold bildet die Hintergrundfolie für die großfigurigen Szenen, die in kräftigen, gebrochenen Deckfarben ausgeführt sind. Vereinzelte Architekturelemente und Landschaftsangaben dienen lediglich der Verortung des Geschehens. Würdevolle Figuren dominieren den symmetrischen Bildaufbau. Durch eine lebhafte Gebärdensprache und Blicke aus großen Augen treten sie zueinander in Beziehung und vermitteln so den Inhalt des Bildes und zugleich dessen emotionalen Ausdruck.
Vergilius Vaticanus
Antike Weltliteratur in spätantiken Bildern
Entstanden: um 400 in Rom
Rom, Bibliotheca Apostolica Vaticana
Umfang: 152 Seiten
Format: 22,5 x 20 cm
Miniaturen: 50 Miniaturen
Einband: Ledereinband
Auflage: 750 nummerierte Exemplare
Inklusive Kommentarband
Der Vergilius Vaticanus ist das wichtigste erhaltene Beispiel eines illustrierten Buches der Antike und stellt zugleich eine der ältesten Überlieferungen von Vergils berühmtem Nationalepos Aeneis dar. Entstanden in Rom um 400 n. Chr., ist er zudem das älteste von insgesamt nur drei antiken Manuskripten mit illustrierter klassischer Literatur.
Besondere Wertschätzung genießt der Vergilius Vaticanus auf Grund seines reichen Buchschmucks. 50 Miniaturen begleiten den Text in anschaulicher Weise und machen die Handschrift so zu einem Prachtcodex von höchstem künstlerischen Anspruch. Die mit üppigen Farben aufgetragenen Illustrationen lassen in ihrem Stil die Parallelen zu den pompejanischen, nach griechischen Vorbildern geschaffenen Wandmalereien deutlich erkennen.
Codex Aureus Escorialensis Prachtausgabe
Das salische Kaiser-Evangeliar
Entstanden: Um 1045/46 in Echternach
Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, Madrid
Format: 50,0 x 35 cm
Umfang: 340 Seiten
Miniaturen: 13 ganz- und 43 halbseitige Miniaturen, 12 Kanontafeln, 44 prunkvollen Zierseiten,
18 Seiten mit zwei Zierkolumnen und 11 Seiten mit einer Zierkolumne, insgesamt 141 vergoldete Schmuckseiten, dazu 124 Ranken-Initialen; jede Textseite der Evangelien mit Kolumnentitel, davon 50 mit
zusätzlicher Trägerfigur (Atlant).
Schrift: Karolingische Minuskel in zwei Kolumnen zu je 36 Zeilen mit dem völlig in Goldtinte geschriebenen Text.
Einband: Rotes Leder mit Goldprägung
Inkl. Kommentarband und Kassette
Auflage: 980 nummerierte Exemplare
Die Handschrift verbindet im geistigen Sinne drei Orte: Echternach im heutigen Luxemburg, Speyer
und den Escorial unweit von Madrid in Spanien wo der Codex aufbewahrt wird, jedoch nicht zugänglich ist und in einem Kühltresor lagert.
Eigentlich wollte der junge Salier-König im Skriptorium des Klosters Echternach nur ein würdiges Gedenkbuch für seine Eltern bestellen, die bereits im entstehenden Dom zu Speyer ruhten. Es wurde jedoch weit mehr daraus: das größte Evangeliar, das je geschaffen wurde, eine Stiftung für den größten Dom, den es zur damaligen Zeit gab.
Im August 1046 hat wohl der fromme Heinrich mit seiner Gattin Agnes des goldenen Pracht-Codex der Patronin Maria zur Weihe des Hochaltars im Dom überreicht, wie es anschaulich im Dedikationsbild dargestellt ist. Das Format und die erstaunliche künstlerische Ausstattung entsprechen durchaus dem grandiosen Dombau.
Heinrich III. hat den Evangelientext Buchstabe für Buchstabe in karolingischer Minuskel mit Goldtinte schreiben lassen. Mit den vier prunkvollen „Vorhang“-Seiten, den zwölf monumentalen Kanontafeln, den vier prächtigen Autoren-Bildern der Evangelisten, der graphisch, ornamental und bildlich überaus reichen Gestaltung ist ein künstlerisches Höchstmaß in der Buchkunst erreicht, das niemals übertroffen wurde. Die Fülle der Differenzierungen und Nuancierungen in der buchgestalterischen Komposition konnte nur in einem Skriptorium auf dem Höhepunkt seiner Leistungskraft wirklich umgesetzt werden, wie es in Echternach zu dieser Zeit existierte.
Der heutige Einband aus dem Jahre 1934 ist ein Replikat jener kunstvollen Fassung, die Philipp V., ein Enkel des Sonnenkönigs, der erste Bourbone auf dem spanischen Thron (1701-46), im französischen Pointillé-Stil anfertigen ließ, goldgeprägt in rotem Leder.
Chansonnier de Jean de Montchenu
Entstanden: Frankreich um 1475
Bibliothèque nationale de France
Umfang: 144 Seiten
Format: 22 x16 cm
Miniaturen: 2 ganzseitige Miniaturen, 127 Seiten mit Illustrationen von Pflanzen, Tieren und mythologischen Wesen, reiches Golddekor
Einband: Herzförmig in rotem Samt
Auflage:1380 nummerierte Exemplare
Antiquarisches Exemplar
Wahrscheinlich um 1475 wurde diese Handschrift, eine Sammlung italienischer und französischer Liebeslieder (und eines spanischen), für Jean de Möndchen, Adeliger, Apostolischer Protonotar, Bischof von Agens (1477) und Visiers (1478-1497) geschaffen.
Ist das Buch geschlossen, hat es die Form eines Herzens. Wird es geöffnet, nimmt es die Gestalt eines Schmetterlings an, gebildet aus den Herzen zweier sich Liebenden, die in ihren Liedern Liebesbekundungen austauschen. Wie leicht vorstellbar, ist bereits die herzförmige Kontur der Handschrift eine Rarität. Einzigartig jedoch sind die bei ihrer Öffnung sichtbare Darstellung zweier verbundenen Herzen und das reichhaltige Dekor.
Die Lieder in französischer und italienischer Sprache, geschrieben für verschiedene Stimmen, sind das Werk einiger der besten mittelalterlichen Tondichter und Musiker. Guillaume Dufay und Johannes Ockeghem, die führenden Komponisten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, zählen dazu. Guillaume Dufay (1397-1474), vom Papst ernannter Kanoniker in Cambrai und Mons, schuf gleicherweise geistliche und weltlich-höfische Musik, Messen und Motetten sowie französische Chansons. Johannes Ockeghem (1410-1497), flämischer Komponist und Kleriker, Sanger am Hof des französischen Königs Karl VII., Schatzmeister der Kirche St. Martin in Tours und Diplomat des Papstes, war einer der herausragendsten Bassisten seiner Zeit.
Im Codex stehen sich zwei ganzseitige Miniaturen gegenüber. In der ersten schließt Liebesgott Cupido mit seinen Pfeilen auf eine junge Dame, während die Schicksalsgöttin Fortuna das Lebensrad dreht. In der zweiten nähern sich die Verliebten einander. Pentagramme, Musik und Liebesgedichte sind umgeben mit Illustrationen von Tieren, Vögeln, Hunden und Katzen sowie aller Arten von Blumen und Pflanzen, erhöht durch die reiche Verwendung von Gold. Zu Harmonie und Eleganz des Codex trägt auch der Einband aus blutrotem Samt bei, der dieses „Buch des Herzens“ umschließt.
Chansonnier de Jean de Montchenu
Bible moralisée
Entstanden:13. Jahrhundert
Umfang: 131 Seiten
Format: 26 x 34,4 cm
Miniaturen: 1032 prachtvolle vergoldete Miniaturen auf Pergamentpapier
Einband: Roter Samteinband mit Beschlägen
Auflage: 200 nummerierte Exemplare
Verlag: Imago
Inkl.: Kommentarband
Die berühmte Bible moralisée ist eine der prächtigsten gotischen Handschriften aus dem 13. Jahrhundert.
Die 131 Bildseiten sind geschmückt mit 1032 vergoldeten Miniaturen und einem ganzseitigen Vollbild, das mit der Darstellung Gottes als Architekt des Universums große Berühmtheit erlangt hat.
Die Bible moralisée ist auch ohne Text lesbar. Sie wurde durchgehend nach folgendem Schema gestaltet:
Auf jeder Seite sind 8 Medaillons zu einem Block zusammengefügt, der jeweils links und rechts von vier Textabschnitten begleitetet wird. Das Ganze wird durch einen schmalen Rahmen umschlossen.
Inhaltlich gehören jeweils zwei untereinander stehende Bildmedaillons und die sie begleitenden Texte zusammen. Im oberen Textabschnitt wird eine Passage aus der Bibel zusammengefasst oder paraphrasiert, in der Miniatur daneben ist die Szene dargestellt. Der Textabschnitt darunter enthält eine Auslegung des Bibeltextes, die wiederum illustriert ist. Der Bildzyklus ist jeweils vom Bildpaar links oben beginnend zu lesen, anschließend das Bildpaar rechts oben, dann das links unten und schließlich rechts unten.
Die einzigartige Wirkung dieser Bilderhandschrift geht von den vergoldeten, farbigen Bildmedaillons aus, in denen Szenen aus Büchern des Alten Testamentes dargestellt sind. Der Inhalt dieser Szenen ist schon allein durch diese Illustrationen lesbar; der begleitende Text fasst die jeweilige Passage zusammen oder paraphrasiert sie. Die Miniaturen überzeugen durch die Durchschlagskraft der Erzählung, ihre Eindeutigkeit und auch Drastik.
Bible moralisée
Das Passauer Evangelistar
Romanische Buchkunst in Gold und Silber
Entstanden: 1170–1180 in Passau (St. Nikola)
München, Bayerische Staatsbibliothek
Umfang: 88 Seiten
Format: ca. 32,5 × 22,5 cm
Miniaturen: 49 große Zierinitialen und 8 ganzseitige Miniaturen
Einband: Matt schimmerndes Gewebe aus Halbseide, das prachtvoll mit Tier- und Pflanzenmotiven gemustert ist, in einer Präsentationskassette aus Acrylglas
Auflage: 680 nummerierte Exemplare
Inkl. Kommentarband
Im 12. Jahrhundert entstanden in den Passauer Skriptorien kostbare Handschriften, die von weltlichen und geistlichen Fürsten hochgeschätzt wurden. Doch haben Brände und Erdbeben diese reiche Handschriftenüberlieferung fast zur Gänze ausgelöscht. Beim Brand von 1389 wurden die Bestände in der Bibliothek von St. Nikola fast vollständig vernichtet. Umso schätzbarer ist der Wert des Passauers Evangelistars, da es heute beinahe das einzige erhaltene Zeugnis für die künstlerisch hochstehende und eigenständige Passauer Buchmalerei aus der Zeit der Romanik ist.
Das Passauer Evangelistar ist das kongeniale Werk zweier Buchmaler, die Miniaturen und Initialen geschaffen haben. Sie sind benannt nach den Sujets ihrer Hauptminiaturen „Petrus-Meister“ und Ecclesia-Meister“. Die zwei Buchmaler sind deutlich von Stilelementen der byzantinischen Malerei beeinflusst.
Das Passauer Evangelistar
Codex Purpureus Rossanensis
Entstanden: 6. Jahrhundert
Format: 31 x 26 cm
Umfang: 386 Seiten
Miniaturen: 15
Miniaturseiten. Der Text ist durchgehend in Gold und Silber geschrieben
Einband: Der Einband besteht aus massiven Holzdeckeln mit Halblederdecke.
Auflage: 750 nummerierte Exemplare
Inkl. Kommentarband
Der Codex Purpureus Rossanensis ist wohl
eine der wertvollsten und faszinierendsten Handschriften der Welt. Vielfältige Gründe sind es, die diesen Codex zu einer wahren Welthandschrift machen. Die perfekte Ausführung der 15 Miniaturseiten
begeistert den Betrachter – sie stellen ein unersetzlich kostbares Dokument der des 6. Jahrhunderts dar. Geschaffen vor beinahe 1500 Jahren, ist der Codex Purpureus eine der ältesten
Bilderhandschriften der Welt. Königlich ist sein Erscheinungsbild – die purpurne Färbung des Pergaments machte die Handschrift bekannt und berühmt.
Der Text der 386 Seiten ist durchgehend in silbernen und goldenen Majuskeln geschrieben. So umfasst der Text das vollständige Matthäus-Evangelium und das vollständige
Markus-Evangelium.
Codex Purpureus Rossanensis
Aratea Vaticana
Umfang: 200 Seiten
Format: 23,2 x 15,1 cm
Erschienen: Zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts
Buchschmuck: 40 Diagramme und Miniaturen; 1 aufwändig gerahmte Incipit-Seite; 60 goldene Feldinitialien
Inkl. Kommentarband
Der Dichter Aratos von Soloi liefert mit seinem antiken Text des Phainomena, das Vorbild für das astronomische Lehrbuch, die Aratea Vaticana. Die Planeten, Himmelserscheinungen und Wetterzeichen, werden mit 40 großen goldgeschmückten Miniaturen erläutert und dargestellt.
Angefertigt wurde diese astronomische Handschrift für König Ferdinand I. von Nepal oder seinem Sohn Johannes. Sie ist ein perfektes Beispiel für ein literarisches und künstlerisches Zeugnis der Frührenaissance in Italien.
Kardinal Maffeo Baerberini, der später Papst Urban VIII. wurde, erteilte persönlich den Auftrag den einband mit Samt zu umhüllen und kostbar zu besticken.
Aratea Vaticana
Das Goldene Hildesheimer Kalendarium
Deutsche Buchmalerei zwischen Romanik und Gotik
Entstanden: 13. Jahrhundert
Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel
Umfang: 16 Seiten
Format: ca. 31 x 22,5 cm
Miniaturen: Vollständiger Kalender auf 9 Seiten sowie 2 ganzseitige Miniaturen
Einband: Brauner Ledereinband
Auflage: 980 Ausgaben
Inkl.: Kommentarband
Das Hildesheimer Kalendarium entstand im Skriptorium des Benediktinerklosters St. Michael in Hildesheim
Diese Prachthandschrift umfasst auf 9 Seiten einen vollständigen Kalender mit reichem Architekturschmuck und Tierkreiszeichen sowie 5 Darstellungen zum Leben Christi auf 2 Bildseiten.
Das außer-gewöhnliche Kalendarium spiegelt das harmonische Zusammentreffen eines sich wandelnden Kunstverständnisses in einer spannungsgeladenen, lebendigen Ausdrucksweise wieder.
Das Goldene Hildesheimer Kalendarium
Guido de Columnis - Der Trojanische Krieg
Entstanden: 15. Jahrhundert
Österreichische Nationalbibliothek, Wien
Format 37 x 27,5 cm
Umfang: 478 Seiten
Miniaturen: 343 großformatige mit Gold und Silber ausgeschmückte Miniaturen
Einband: Ledereinband mit vier Schließen und
fünf Bünden, die Rahmenecken und die Buchdeckelmitte sind
mit einer Wirbelrosette in Echtgold besetzt.
Auflage: 980 nummerierte Exemplare
Inkl. Kommentarband
Im 13. Jahrhundert verfasste Guido de Columnis seine Historia destructionis Troiae: die Geschichte von der Zerstörung Trojas. Die Geschichten um die schöne Helena und den Helden Achill, Hector und Odysseus werden in den bezaubernden, reich mit Silber und Gold geschmückten Miniaturen wiedergegeben.
Guido de Columnis - Der Trojanische Krieg
Wolfram von Eschenbach: Willehalm
Ein deutsches Heldenepos in goldenen Bildern
Entstanden: um 1320, Westdeutschland
Wien, Österreichische Nationalbibliothek
Umfang: 702 Seiten
Format: 31 x 22 cm
Miniaturen: 117 Miniaturen, 15 große Initialen
Einband: Leder, dem Charakter der Handschrift entsprechend
Inkl. Kommentarband
Dieses wohl berühmteste höfische Epos des Mittelalters zählt zu den meistgelesenen Dichtungen der Geschichte. Es wurde zu Beginn des 13. Jh.s von Wolfram von Eschenbach (1170–1220) verfasst, dem wohl bedeutendsten Vertreter mittelhochdeutscher Epik. Obwohl über sein Leben sehr wenig bekannt ist, gilt es doch als sicher, dass er dem Adelsstand angehörte. Seine herausragenden literarischen Werke inspirierten viele Literaten der folgenden Jahrhunderte. (Adeva)
Willehalm verteidigt seine Gemahlin Gyburc, die getaufte Tochter des Heidenkönigs Terramer, gegen das zu ihrer Befreiung angerückte Heidenheer; sie hatte Willehalm zuvor aus der Gefangenschaft befreit und war ihm in seine Heimat gefolgt. In der ersten Schlacht unterliegen die Christen. In den Vordergrund rückt dann die Gestalt des jungen Rennewart, des Bruders von Gyburc. Er tritt in Willehalms Dienste und trägt in der zweiten Schlacht mit gewaltigen Keulenschlägen entscheidend zum Sieg der Christen bei. (Adeva)
Wolfram von Eschenbach: Willehalm
Lateinischer Dioskurides
Entstanden: Um 1400
Italien
Umfang: 488 Seiten
Format: 28,3 x 19,8 cm
Einband: Rotes Leder mit Goldprägungen und Schließen
Inkl. Kommentarband
Bei de Lateinischer Dioskurides handelt es sich um ein Exemplar der berühmter Dioskurides Handschriften. Der Dioskurides präsentiert ein Umfassende Übersicht über Heilpflanzen und andere natürliche Heilmittel, ihre Wirkung und Anwendungen.
Der Dioskurides befindet sich im Besitzt vom Papst Alexander VII. und heute in der Biblioteca Apostolica Vaticana, er entstand wohl in Italien um 1400.Er überzeugt mit seinen wunderschönen ganzseitigen kolorierten Darstellungen, der Heilmittel und bietet einen Einblick in die Antike Medizin und Botanik.
Lateinischer Dioskurides
Marco Polo: Buch der Wunder
Entstanden: Um 1410
Bibliotheque nationale, Paris
Format: 42 x 30 cm
Umfang: 192 Seiten
Miniaturen: 84 großformatige Miniaturen, zahlreiche kleine Goldinitialen im Tex
Einband: Brauner Lebereinband mit Königswappen und Rückenvergoldung
Auflage: 980 nummerierte Exemplare
Inkl. Kommentarband.
Beim Verlag vergriffen!
Der Entstehungsort der berühmten Bilderhandschrift über die abenteuerlichen Reisen des venezianischen Kaufmanns Marco Polo (1254-1324) mit 84 Miniaturen in herrlichen Farben und reichem Goldschmuck kann nur vermutet werden. Auftraggeber und ursprünglicher Besitzer war wohl Johann Ohnefurcht, Herzog von Burgund, der in den Inventaren des Herzogs von Berry als derjenige vermerkt ist, der dem Herzog das Prachtwerk geschenkt hat. Die großformatigen Miniaturen können zwei Stilgruppen zugeordnet werden. Der Boucicaut-Meister prägt eine von ihnen, unterstützt vom Mazarine-Meister, während die zweite Gruppe von der engen Zusammenarbeit des Egerton-Meisters und des Bedford-Meisters bestimmt wird. Die Geschichte, welche die Buchmaler illustrieren, ist die des Handelsreisenden Marco Polo. Die Wirklichkeitsschilderung und phantasievolle Ausschmückung verbindenden Berichte seines mutigen und mühevollen Abenteuers, das ihn 1271 von Venedig in dreieinhalb Jahren bis an den sagenumwobenen Hof des Mongolenherrschers Kublai Khan reisen ließ, faszinieren noch heute den Leser, wie sie bereits Kolumbus beeinflussten, der selbst ein Exemplar der Handschrift besaß.
Marco Polo - Das Buch der Wunder
Der Pariser Alexanderroman
Entstanden: ca. 1420/25, Paris
British Library, London
Umfang: 194 Seiten
Format: ca. 28,4 x 19,5 cm
Miniaturen: 86 Miniaturen, mehr als 100 mehrzeilige goldene Initialen
Einband: Brauner Ledereinband mit drei feinen goldgeprägten Rahmenlinien sowie dem Wappen des
letzten Besitzers, König Georg II, auf dem Vorderdeckel.
Auflage: 680 handnummerierte Exemplare
Inkl. Kommentarband
Der Pariser Alexanderroman gilt zweifelsohne als eine der prachtvollsten Alexander-Handschriften des ganzen Mittelalters. Die 86 Miniaturen sind fast auf jedem Blatt der Handschrift zu finden. Sie erzählen in ihrer Schönheit der gotischen Bildersprache von der mythischen Abkunft Alexanders, dem Unterricht bei Aristoteles. Die Schlachten gegen den Perserkönig Darius sind in den Miniaturen wiedergegeben sowie Bilder Alexanders Zug bis nach Indien. Der Alexanderroman ist in Altfranzösisch verfasst.